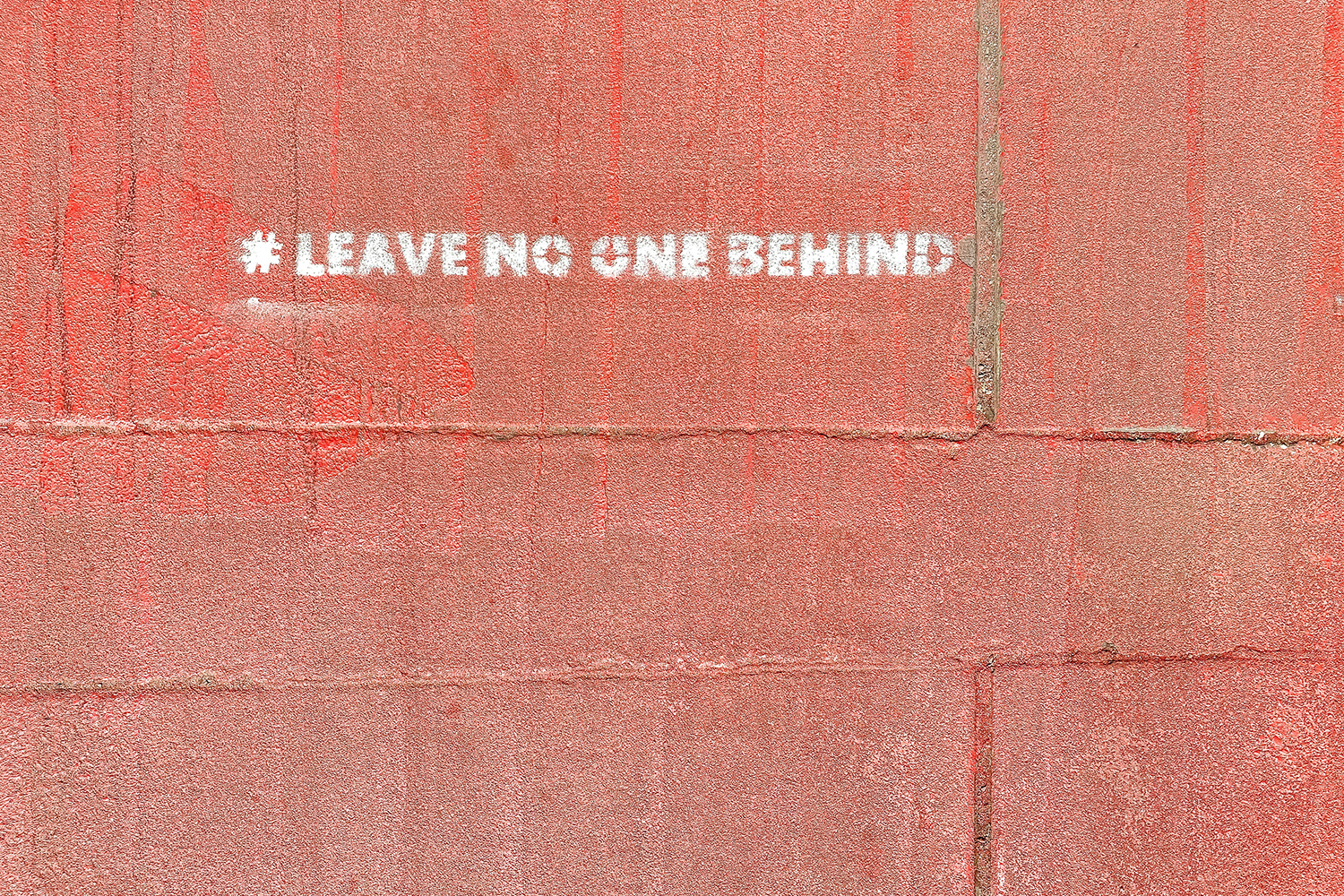Das gesetzliche Krankenversicherungssystem in Deutschland funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip: Die Gesunden helfen den Kranken. Doch was ist mit den Menschen, die auf der Straße leben und oft gar keine Krankenversicherung haben? Wir haben nachgefragt bei Klaus Bornemeyer und Werner Funkel, die wohnungslose Menschen ärztlich betreuen.
Fotos: David Ertl, Text: Carolin Scholz
Dass zwei Ärzte vor einem stehen, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Dr. Klaus Bornemeyer und Dr. Werner Funkel tragen keine weiße Kleidung und erst recht keinen Kittel. Das Einzige, woran man ihren Beruf und ihre Aufgabe an diesem Tag erkennen kann, ist die Tasche. Ein großer rotgelber Rucksack, den man schon mal in der Hand eines Sanitäters oder einer Notärztin gesehen haben könnte. Dass die beiden nicht die typische Arzt-Kleidung tragen, ist eine bewusste Entscheidung. Denn auf die, für die sie hier sind, kann so ein formales Erscheinungsbild auch abschreckend wirken.
Das Shelter an der Liefergasse in der Düsseldorfer Altstadt ist den ganzen Tag geöffnet. Wohnungslose Menschen bekommen dort eine warme Mahlzeit, können duschen oder mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen – wenn sie ein Problem haben, aber auch einfach so. Seit einiger Zeit gibt es außerdem einmal pro Woche die Arzt-Sprechstunde. Die ist Teil des Projekts gesund.zeit.raum, das seit 2016 verschiedene medizinische, sozialarbeiterische und präventive Angebote zusammenbringt.
Klaus Bornemeyer ist seit 2020 dabei, vor etwas mehr als einem Jahr ist auch Werner Funkel dazugekommen. Beide sind Urologen und kennen sich schon seit vielen Jahren. Vor ihrem ehrenamtlichen Einsatz haben sie in ihren eigenen Praxen gearbeitet. Mittlerweile sind sie im Ruhestand und wollen die gewonnene Zeit für etwas Sinnvolles nutzen, wie sie sagen. Sie sind zwei von vier Ärzt*innen, die jede Woche zu verschiedenen Tagesstätten für Wohnungslose in Düsseldorf fahren und dort eine medizinische Erstversorgung übernehmen.
Notfalltopf für Rezepte
Der Raum, in dem die Sprechstunde stattfindet, ist eng. Ein Schreibtisch steht an einer Seite, an der anderen ein weiterer Tisch mit zwei Stühlen. Hier legen die beide Ärzte ihren Rucksack ab. Darin ist ein Grundstock an Material, das sie brauchen könnten: Verbandszeug, Antibiotika, Schmerztabletten. Vieles sind Musterpackungen. Für spezielle Medikamente können die Ärzte Privatrezepte ausstellen, die aus dem Notfalltopf des Projekts bezahlt werden. Eine Verbesserung der Gesundheit könne Menschen eine neue Perspektive eröffnen, erklärt Kai Lingenfelder, Projektleiter von gesund.zeit.raum.
Wenn die Sprechstunde wie heute um 15 Uhr beginnt, haben sich meist schon Menschen angemeldet – die Sozialarbeiter*innen fragen vorher, ob jemand Bedarf hat. Im Durchschnitt sind es etwa zwei bis sieben pro Sprechstunde. Manche brauchen nur ein einzelnes Mal Unterstützung, andere kommen immer wieder. Die Erkrankungen und medizinischen Probleme, die die Ärzte hier behandeln, lassen sich leicht zusammenfassen: alles, was mit Hygiene zu tun hat, mit Drogen- und Alkoholkonsum, mit Gewalt, aber auch der „jahreszeitliche Wahnsinn“, wie Werner Funkel es nennt, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit. „Oft sind es Sachen, die wir im Praxisalltag lange nicht mehr gesehen haben“, sagt Klaus Bornemeyer. Befall mit Läusen und Flöhen etwa oder Krätze. Immer wieder haben die Patient*innen auch offene Beine und Wunden, die lange nicht verheilen, weil Verbände nicht so oft gewechselt werden, wie es nötig wäre.

Die Scham ist groß
Häufig haben diese Menschen keine Krankenversicherung. Doch auch wenn sie versichert sind, ist ein Besuch in einer normalen Arztpraxis oft nicht einfach. Wer auf der Straße lebt, kann vor einem Arztbesuch nicht mal eben unter die Dusche springen und frische Sachen anziehen. Die Hemmschwelle, sich in das Wartezimmer einer Praxis zu setzen, ist hoch – und andere Dinge, wie die Suche nach einem Schlafplatz oder der nächsten Mahlzeit sind oft wichtiger.
Neben den alltäglichen, kleineren medizinischen Fragen stehen die Ärzte immer wieder auch vor größeren Herausforderungen: ein gebrochener Arm, ein Nierenstein oder eine Krebserkrankung. Wenn Menschen, die zur Sprechstunde in den Tagesstätten kommen, eine Behandlung von Spezialist*innen, im Krankenhaus oder sogar eine Operation brauchen, leisten die Ärzte doppelte Überzeugungsarbeit. Sie rufen ehemalige Kolleg* innen an für einen Termin auch ohne Krankenkassenkarte oder für ein gutes Wort bei der Verwaltung der Krankenhäuser in der Umgebung. „Unsere Kontakte sind da oft wichtig“, sagt Klaus Bornemeyer. Trotzdem: Bei schwierigen Fällen sind die Ehrenamtlichen und Sozialpädagog*innen der Einrichtungen immer im Austausch miteinander. „Wir besprechen das und suchen auch gemeinsam nach Lösungen“, sagt Kai Lingenfelder.
Es sollte doch selbstverständlich sein, zu helfen
Die Behandlung von Menschen ohne Versicherung ist immer eine Frage des Geldes. In einer niedergelassenen Praxis ist das einfacher, der Arzt oder die Ärztin kann dort selbst entscheiden, ob er oder sie eine Untersuchung macht. In einer Klinik muss immer die Verwaltung überzeugt werden. Nicht nur eine Operation selbst kostet Geld: „Da kann ein Chirurg sagen, er macht die OP auch so“, sagt Werner Funkel. Aber damit ist es eben nicht getan. Material, wie Verbände, Infusionen, Medikamente, kosten Geld, auch das Bett, der Aufenthalt an sich also. Es kann dauern, bis sich eine Klinik findet, die das auf sich nimmt. Die Enttäuschung darüber, hört man aus den Erzählungen von Klaus Bornemeyer. „Es sollte doch selbstverständlich sein, zu helfen.“
Wenn sich ein Krankenhaus bereit erklärt, einen Menschen ohne Versicherung zu behandeln, beginnt der zweite Teil der Überzeugungsarbeit: beim Patienten oder der Patientin. Wenn die Hürde, in eine Praxis zu gehen, schon hoch ist, ist die für eine Krankenhausbehandlung nochmal ein ganzes Stück höher.
Keine Krankenakten
Heute ist ein junger Mann in der Sprechstunde. Er hat einen Ausschlag am linken Arm und ist nicht zum ersten Mal da. Wie alle anderen möchte er anonym bleiben. „Es ist nicht so einfach, wenn man auf der Straße lebt“, sagt er. Er wirkt, als wäre es ihm wichtig, dass man ihm seine Lebenssituation nicht ansieht. Die Ärzte führen hier keine Krankenakten, schreiben nicht auf, wer wann und wie oft hier war – oder wer dann nicht mehr gekommen ist.
Werner Funkel untersucht den Arm des Patienten, tastet den Lymphknoten. Offenbar ist es seit dem letzten Mal besser geworden. Später erzählt Klaus Bornemeyer, der Patient habe eine Blutvergiftung gehabt, ihm sei wohl irgendwann eine Metallplatte in den Arm eingesetzt worden, mit der es Probleme gegeben habe. Er habe ihm auch einen Termin beim Hautarzt besorgt, doch den habe er schlussendlich nicht wahrgenommen.
Helfen hat immer viel mit Zuhören zu tun
Auch damit müssen die Ärzte sich abfinden – dass ihr Einsatz immer wieder mal ins Leere läuft. Viele der Menschen, die zu ihnen kommen, haben auch psychische Erkrankungen. Manchen fehlt das Bewusstsein dafür, wie wichtig ein Termin beim Arzt für sie wäre, bei anderen wird die Angst und die Hemmung am Ende doch zu groß. Ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, die Bornemeyer und Funkel leisten, ist deshalb auch, Vertrauen aufzubauen. Ziel ist es auf lange Sicht, dass die Menschen über die niedrige Schwelle der Sprechstunde in der Tagesstätte Vertrauen fassen und später auch wieder die normale Regelversorgung nutzen. „Helfen hat hier immer auch viel mit Zuhören zu tun. Das ist in einer normalen Praxis oft nicht in dem gleichen Rahmen möglich wie hier“, sagt Kai Lingenfelder.
Die Sprechstunde ist also immer ein Zusammenspiel von Sozialarbeit und Medizin. Patient*innen, die öfter kommen, erzählen auch irgendwann mehr von ihrer Situation und davon, wie sie an dieser Stelle in ihrem Leben gelandet sind. Immer wieder sind da auch Geschichten dabei, die im Kopf bleiben. Die vom früheren talentierten Immendorff-Meisterschüler etwa oder von der ehemaligen Kinderchirurgin, denen die beiden Ärzte bei ihrer Sprechstunde für wohnungslose Menschen begegnet sind.
Der Kontakt reißt meist irgendwann ab „Wenn Menschen schon einmal etwas erreicht hatten und ihr Leben dann aus den Fugen gerät, das beschäftigt besonders“, sagt Klaus Bornemeyer. Auch weil der Kontakt meist irgendwann abreißt. Wenn die Menschen plötzlich nicht mehr zur Sprechstunde kommen, ist oftmals nicht in Erfahrung zu bringen, wie es mit ihnen weitergegangen ist. Auch darüber sind Ärzte und Sozialpädagogen immer wieder im Austausch.
Eine gewisse emotionale Distanz zu halten, das kennen die Ärzte aus ihrer langjährigen Berufserfahrung bereits. Dass man nur bis zu einem gewissen Grad helfen kann oder akzeptieren muss, wenn jemand Hilfe oder Ratschläge nicht annimmt, damit muss man auch im Praxisalltag leben. „Nach 40 Jahren im Beruf bin ich davon nicht emotional gestresst“, sagt Werner Funkel, „aber ich komme nach der Sprechstunde geerdet nach Hause und weiß zu schätzen, in welcher Situation ich selbst bin.“
Weitere Themen
Abschied
Armut
Aufbruch
Wohnen
Zusammenhalt
Berührung
Ankommen
Einsamkeit
Durch das Projekt gesund.zeit.raum erhalten wohnungslose und armutsgefährdete Menschen Angebote zur Förderung von Gesundheit und Teilhabe. Das Projekt wird durch das forschende Pharmaunternehmen Janssen (Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) finanziert. Zu Jahresbeginn hat das Unternehmen seine Förderung der Diakonie Düsseldorf um weitere drei Jahre verlängert. Janssen unterstützt die Diakonie im Rahmen des Projekts gesund.zeit.raum bereits seit 2016 nicht nur finanziell, sondern auch mit persönlichem Einsatz der Mitarbeitenden in sogenannten Corporate-Volunteering-Aktionen.