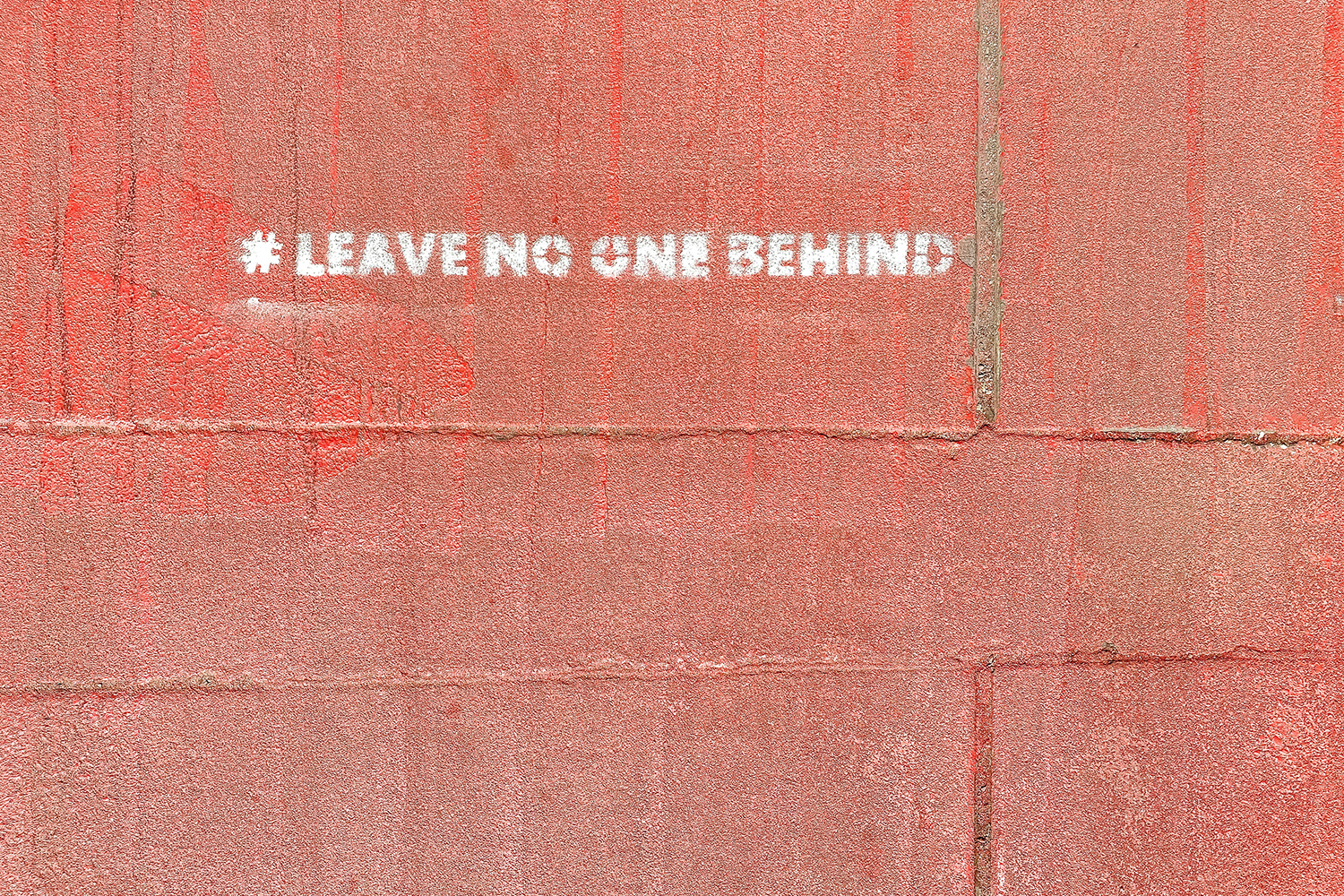Gespräch: Marc Latsch
Dr. Ulf Tranow ist Soziologe und einer der renommiertesten Solidaritätsforscher in Deutschland. Im Gespräch erläutert er ein Grundprinzip, das jeder anders versteht, aber dadurch viel über uns selbst verrät. Und er erklärt, warum Solidarität nicht immer positiv ist, doch gerade in Krisen die Lösung für ein friedlicheres Zusammenleben sein muss.
Herr Tranow, als wie solidarisch würden Sie sich selbst bezeichnen?
Meine Forschung hat mich für Solidarität sensibilisiert. Dadurch fällt mir eher auf, wo ich nicht solidarisch bin. Wenn ich zum Beispiel bei der vierten Spendenanfrage kein Geld mehr gebe. Solidarität hat immer etwas mit knappen Ressourcen zu tun. Irgendwann ist ein gewisser Sättigungsgrad erreicht. Aber im Grunde genommen würde ich mich als solidarisch bezeichnen.
Hängt das auch damit zusammen, dass es durch die Krisenhaftigkeit unserer Zeit so viele aktuelle Anlässe gibt?
Entscheidender ist die Frage, wofür wir solidarisch sind. Unsere Gesellschaft wandelt sich. Wir haben in der Corona- Pandemie und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal festgestellt, dass es in akuten Krisen eine hohe Solidaritätsbereitschaft gibt. Das hatten wir als Gesellschaft ein bisschen unterschätzt. Was akute Krisensituationen angeht, besitzen wir eine ausgeprägte und verlässliche Solidarität. Die Alltagssolidarität, beispielsweise am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, ist im Schatten dieser ereignisbezogenen Solidarität eventuell etwas brüchiger geworden.
Hängt das auch damit zusammen, dass es durch die Krisenhaftigkeit unserer Zeit so viele aktuelle Anlässe gibt?
Das hat mit vielen Dingen zu tun. Krisen provozieren Solidarität, sie nutzt sich aber auch sehr schnell ab. Die protestierenden Frauen im Iran wurden sehr stark medial aufgegriffen, es gab zahlreiche Solidaritätsbekundungen. Obwohl sich an der Situation nichts änderte, gingen wir relativ schnell wieder zum Alltag über. Unsere Aufmerksamkeitsökonomie treibt uns dazu, kurzfristig, aber da-für sehr emphatisch Solidarität zu äußern. Das liegt an der medialen Berichterstattung, aber auch an unseren sozialstrukturellen Voraussetzungen. Die Menschen sind mobiler und individueller geworden. Ihre Aufmerksamkeit ist weniger an Familie und Nachbarschaft gebunden.
Ist Solidarität erlernbar?
Auf jeden Fall. Der größte Lerneffekt besteht, wenn wir erfahren, dass unsere Solidarität keine Einbahnstraße ist, sondern wir im Bedarfsfall ebenfalls unterstützt werden. Solidarität ist dann eine starke Ressource für gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn sie von einem Einszu- eins-Austausch entkoppelt ist. Wenn es ein Vertrauen in eine generalisierte solidarische Unterstützung gibt. Ohne dieses Vertrauen bleibt Solidarität in komplexen Gesellschaften sehr beschränkt.
Also spielt Eigennutz bei Solidarität auch eine Rolle?
Solidarität impliziert, dass man Kosten auf sich nimmt ohne die Sicherheit, etwas zurückzubekommen. Wenn wir aber damit rechnen können, dass unsere Solidarität erwidert wird, dann können Eigeninteressen unsere Motivation stärken. Wenn Solidarität beispielsweise aus Gründen einer Ressourcenasymmetrie nur einseitig möglich ist, werden ethische Erwägungen wichtiger, um uns zu motivieren. Es ist also eine hybride Sache, die sich nicht allein auf Eigennutz oder Moral reduzieren lässt. Eine Ertragsgarantie gibt es bei Solidarität aber nicht.
Dem Alltagsverständnis nach ist Solidarität immer etwas Positives. Sie warnen vor dieser Ansicht. Warum?
Solidarität bedeutet, dass wir Kooperationsverpflichtungen aus einem Zusammengehörigkeitsgefühl ableiten. Es gibt Situationen, in denen solche Netzwerke kontraproduktiv sind. Auch Terrororganisationen und Rechtsextremisten benötigen Solidarität, um als Gruppe zu funktionieren. Das ist die dunkle Seite der Solidarität. Außerdem könnte eine zu starke Solidarität dazu führen, dass es ökonomisch weniger Leistungsanreize gibt. Zu viel Solidarität kann schädlich sein.
Verstehen wir unter Solidarität nicht ohnehin alle etwas anderes?
Solidarität ist ein höchst umstrittener Begriff. Er war zunächst progressiv definiert und sehr stark mit der Arbeiterbewegung verbunden. Mittlerweile nutzt auch die Rechte den Begriff. Auch in der Religion spielt der Begriff eine starke Rolle. Es gibt aber ein universelles Kernelement. Das Grundprinzip von Solidarität ist, dass wir als Angehörige einer Gruppe bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen, die uns zu gegenseitiger Unterstützung verpflichten. Auch wenn es mit Kosten verbunden ist. Dann stellen sich weitere Fragen, die aus linker, rechter und religiöser Perspektive sehr unterschiedlich beantwortet werden: Wer ist die Gruppe? Wer gehört zu uns und wer nicht? Wie viel Solidarität ist angemessen?
Ist es ein Fortschritt der liberalen Gesellschaft, dass jede*r entscheiden kann, in welcher Form er oder sie solidarisch ist?
Es ist ein großer Fortschritt, dass wir freier über unsere Solidaritätsressourcen verfügen können. In traditionalistischen Strukturen ist das nicht möglich. Dort muss die Absicherung sehr lokal organisiert sein. Durch den Wohlfahrtsstaat sind wir von diesen Verpflichtungen entlastet. Konservative beklagen das teilweise. Man könnte aber auch sagen: Weil es Dienstleister für Pflege und sozialstaatliche Einrichtungen gibt, können die Solidaritätsressourcen überhaupt außerhalb der Familie genutzt werden. Das halte ich für einen Fortschritt.
Profitieren aber nicht auch Extremisten, wenn alte Solidarstrukturen bröckeln?
Gerade Rechtsextremisten profitieren von dem Gefühl einzelner gesellschaftlicher Gruppen, nicht mehr im Solidarfokus zu sein. Bei Solidarität geht es immer auch um Anerkennung und Zugehörigkeit. Wenn Teile der Gesellschaft sich mit ihren Sorgen und Nöten nicht mehr beachtet fühlen, kann der Rechtspopulismus eine alternative Solidargemeinschaft bieten.
Ist es nicht auch hochpolitisch, wem gegenüber man sich solidarisch zeigt?
Solidarität ist immer selektiv. Es hat etwas Politisches, ob wir uns eher den ukrainischen Bürger*innen oder „unseren“ Obdachlosen und Rentner*innen gegenüber solidarisch zeigen. Außerdem sind manche Konfliktlagen, wie im Nahen Osten, so kompliziert, dass sich Solidarität sehr ungerecht anfühlen kann. Wer sich stark für die Belange der Menschen in Gaza einsetzt, muss sich dann anhören, dass er die Anliegen des Staates Israel und der Jüd*innen nicht im Blick hat. Genauso ist das andersherum. In der Dynamik der politischen Debatten erschwert das Solidarität.
Sind manchmal auch die Grenzen zur Politik-PR fließend?
Das wird schon in den sozialen Medien deutlich, wo wir alle als Kuratoren unseres eigenen Profils auftreten. Wer dort Solidarität bekundet, trifft eine Aussage über sich selbst und stellt sich im öffentlichen Raum dar. Das ist Selbst-PR. Ebenso drücken auch politische Organisationen und Staaten mit ihren Solidaritätsbekundungen Identitäten aus. In diesem Dilemma steckt auch Deutschland, wenn es sich sehr solidarisch mit Israel zeigt. Gerade aus dem Globalen Süden kommt der Vorwurf, dass sich Deutschland im Russland-Ukraine-Konflikt hingegen immer für eine regelbasierte Weltordnung eingesetzt hat. Solidarität und Gerechtigkeit sind nicht immer eins.
Sie haben erwähnt, wie schwer es ist, sich auf einen Solidaritätszweck zu einigen. Eine aktuelle Ausnahme war die Flutkatastrophe an der Ahr, die zu einer schier kollektiven Solidarität führte. Was kam dort zusammen?
Da gab es etwas, was ziemlich konsensfähig ist. Wenn Leben unmittelbar bedroht und Existenzen in den Grundfesten erschüttert werden, erkennt so gut wie jeder den Unterstützungsbedarf. Gerade in einer Naturkatastrophe, wenn Menschen ohne eigenes Zutun in Not geraten. Hinzu kommt, dass es nach der Corona-Pandemie ein großes Bedürfnis gab, aus der Isolation auszubrechen. Die ganz starke Unterstützung vor Ort war meiner Einschätzung nach auch durch ein Ausgehungertsein der Menschen nach kollektivem Handeln motiviert.
Trotzdem ebbte die Hilfe nach einer gewissen Zeit ab, ohne dass die Bedürftigkeit verschwunden war.
Es gibt Halbwertzeiten für Solidarität. Das müssen wir akzeptieren. Wer in der Not spontan solidarisch ist, ignoriert immer auch seine sonstigen Prioritäten. Auf Dauer ist das nicht leistbar. Irgendwann drückt der Alltag mit seinen Problemen. Und natürlich nutzen sich Emotionen ab. Das lässt sich auch bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus beobachten. Die erste Massendemonstration mag für alle noch ein unglaublich gutes Gefühl sein. Aber wenn wir das Woche für Woche machen, wird es irgendwann langweilig. Dann konkurriert der samstägliche Demonstrationsaufruf mit dem Fußballspiel, das wieder attraktiver wirkt.
Ist das auch ein modernes Problem, weil wir heute viel mehr Krisen parallel wahrnehmen und berücksichtigen müssen?
Häufig ist die eine Krise noch gar nicht überwunden, da klopft schon die nächste an. Wir werden Zeugen unfassbar vieler Missstände. Daraus ergeben sich wahnsinnig viele Solidaritätsdilemmata für uns. Wenn wir ernsthaft das globale Klima schützen wollen, leiden bestimmte Gegenden in Deutschland dadurch vielleicht ökonomisch. Das ist eine große Herausforderung.
Menschenrechte sind universell, unsere Solidarität aber nicht. Ist Solidarität immer auch Ausgrenzung?
Solidarität ohne Grenzziehungen gibt es nicht. Wenn ich alle Menschen miteinschließe, gibt es zumindest eine Speziesgrenze. Und beispielsweise beim Thema Abtreibung ist es auch umstritten, wann das Menschsein beginnt, das Anspruch auf Solidarität hat. Selbst wenn wir uns im Prinzip einig wären, wer alles zu uns gehört und Solidarität verdient, ist praktische Solidarität trotzdem selektiv. Uns berühren nicht alle weltweiten Menschenrechtsverletzungen in gleicher Art und Weise. Deswegen ist es manchmal wichtig, universelle Menschenrechte auch gegen Solidargefühle durchzusetzen.
Kann Solidarität dennoch die Lösung für ein friedlicheres Zusammenleben sein?
Unbedingt. Ich glaube, es gibt gar keine Alternative dazu. Dazu müssen wir den Solidarkreis stetig erweitern und dagegen angehen, dass er eingeschränkt wird. Denn sobald jemand herausfällt, nimmt auch unsere Empathie ab. Solidarität entsteht auch aus gegenseitiger Abhängigkeit, da ist die Klimakrise ein gutes Beispiel. Wir sind als Gesellschaft darauf angewiesen, gemeinsam Probleme zu lösen. Dazu müssen wir uns klar machen, dass wir deutlich mehr vereint, als uns trennt.
Weitere Themen
Abschied
Armut
Aufbruch
Wohnen
Zusammenhalt
Berührung
Ankommen
Einsamkeit
Dr. Ulf Tranow, Jahrgang 1975, forscht seit 2004 am Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zunächst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Juniorprofessor und heute als Akademischer Oberrat. Zur Solidarität hat er zahlreiche Essays und Aufsätze veröffentlicht. 2012 erschien sein Buch „Das Konzept der Solidarität: Handlungstheoretische Fundierung eines soziologischen Schlüsselbegriffs“ im VS Verlag für Sozialwissenschaften.