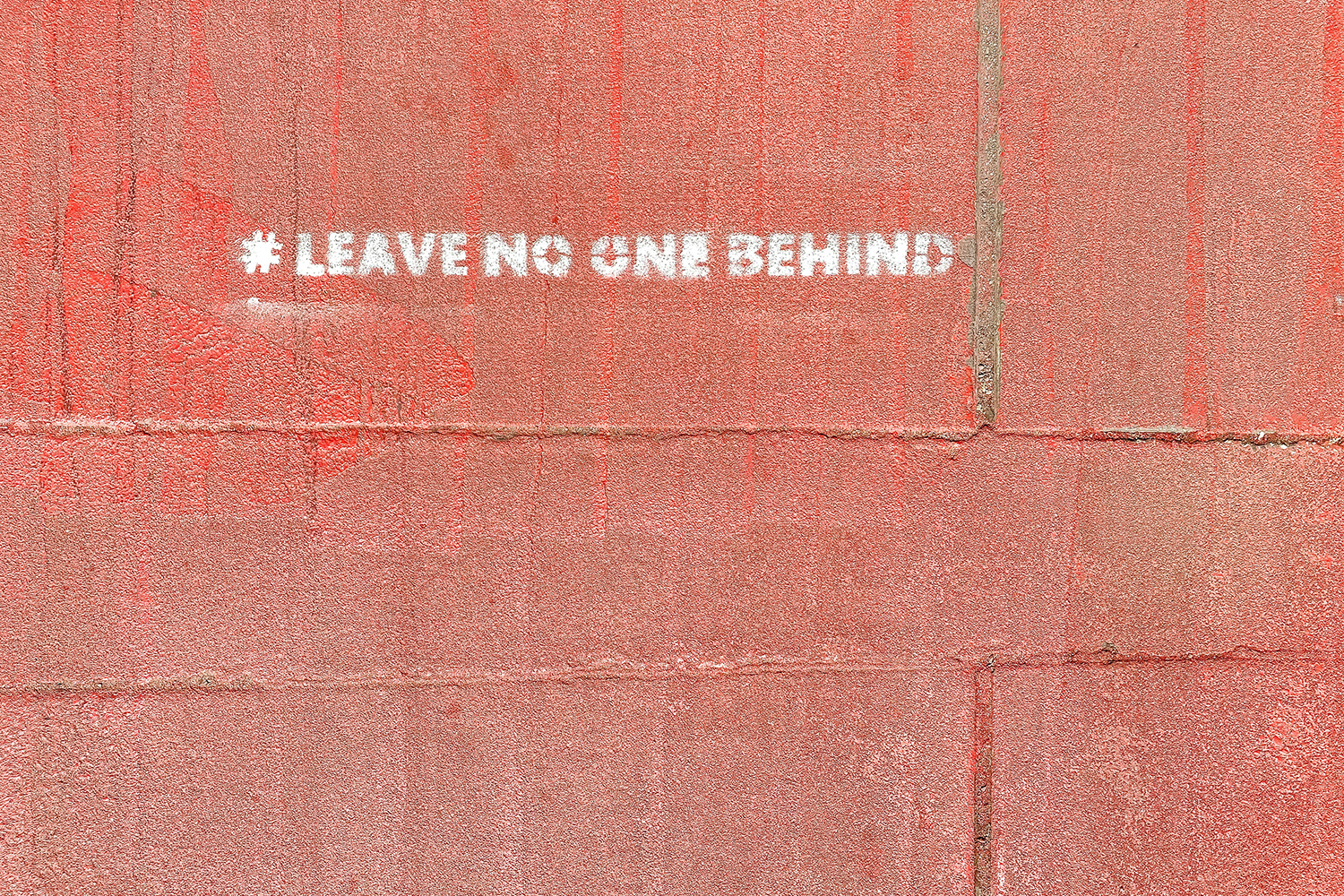Auf Hof Vorberg in Velbert versorgen vier Pächter*innen 200 Mitglieder mit Obst, Gemüse, Eiern und Milchprodukten. Sie sind extra ins Bergische Land gezogen, um dort eine Solidarische Landwirtschaft aufzubauen.
Fotos: Jana Bauch, Text: Marc Latsch
Die Solidarität erstreckt sich in Velbert auf beide Seiten einer wenig befahrenen Landstraße. Auf der einen als Felder, Wiesen und Wald, auf der anderen als Bauernhof mit Ställen, Gewächshaus, Käserei und einem großen Haus im Fachwerkstil. Davor nimmt eine Frau in roter Cordjacke und weiten Blue-Jeans ihre Besucher*innen in Empfang. Miriam Wegerer ist eine von vier Pächter* innen des Hofs Vorberg. Gemeinsam leben und arbeiten sie hier.
Der Hof Vorberg ist eine Solidarische Landwirtschaft. In Deutschland gibt es Hunderte Höfe, Gärtnereien oder private Gruppen, die nach dem Solidarprinzip Ackerbau und Tierhaltung betreiben. Die genauen Konzepte unterscheiden sich von Ort zu Ort, haben aber alle eins gemeinsam: In ihnen schaffen Menschen einen eigenen Wirtschaftskreislauf, den sie selbst organisieren und finanzieren. Einen Schuhwechsel später steht Wegerer in der Käserei des Hofes. Dort wartet Mitpächterin Miriam Ballhaus auf sie, die ein rotes Tuch um die Haare und ein blaues Oberteil voller weißer Flecken trägt. Ballhaus stellt aus der hofeigenen Milch rund 15 Käsesorten her. „Wir wollen die Leute nicht langweilen“, sagt sie und lacht. In einer Solidarischen Landwirtschaft sei Vielfalt ein Vorteil. Anders als in konventionellen Betrieben, die sich meist auf ein Produkt konzentrieren.
Schwer überzeugt vom System
In Velbert versorgen Wegerer, Ballhaus und ihre zwei Mitstreiter*innen derzeit 200 Mitglieder. Die haben sich, je nach Wunschmodell, für eine wöchentliche Ration an Gemüse oder Eiern und Milchprodukten entschieden. Auch Obst bietet der Hof über dieses System an, das muss allerdings selbst gepflückt werden. Die Mitglieder zahlen dafür einen monatlichen Betrag, der nach dem Solidaritätsprinzip festgelegt wird. Einmal im Jahr treffen sie sich zu einer Bieterrunde. Die Hofbetreiber*innen legen ihr Budget offen und dann wird so lange geboten, bis genug Geld zu-sammenkommt. „Nach zwei Runden funktioniert das eigentlich immer“, sagt Wegerer.
Wer mitmachen will, muss sich bewerben
Die vier Pächter*innen kennen sich noch aus Studienzeiten in Witzenhausen, einem Außenstandort der Universität Kassel für Ökologischen Landbau. Dort konnte Wegerer sich bereits in einem Solidarischen Landwirtschaftsprojekt ausprobieren. „Ich bin schwer überzeugt von dem System“, sagt sie. Es sei ein schönes Gefühl, Woche für Woche eine Gruppe zu versorgen, ergänzt Ballhaus.
Auf dem Weg von der Käserei zum Kuhstall geht es um die vielfältigen Arten, wie Solidarität in ihrem Konzept gelebt wird. Um die Solidarität der Mitglieder ihnen gegenüber, wenn sie wetterbedingte Ernteschwankungen mittragen. Und die Solidarität untereinander, wenn manche mehr leisten und mehr zahlen können als andere. Eigentlich sei es auch ein Beitrag für diejenigen, die gar nicht bei ihnen mitmachen, sagt Wegerer irgendwann. „Mit all dem, was unsere nachhaltige Landwirtschaft mit sich bringt, sind wir auch der Gesellschaft und der Natur gegenüber solidarisch.“
Wer sich in Velbert beteiligen möchte, muss sich bewerben, bezahlen, sonst aber nicht viel tun. Das unterscheidet den Hof von anderen, deutlich mitmachorientierteren Konzepten. Es gibt allerdings genügend Möglichkeiten für diejenigen, die sich dennoch einbringen möchten. Die acht Verteilstellen in der Region werden von den Mitgliedern selbst organisiert, es gibt wöchentliche Unterstützungsmöglichkeiten und besondere Aktionstage.
Was mit dieser Hilfe möglich ist, lässt sich am Kuhstall erkennen, in dem Wegerer nun steht. Hinter ihr stapelt sich frisches Heu, rechts neben ihr liegen Kälbchen in der Ecke. „Das war ein Riesenprojekt“, sagt sie. Der Stall ist brandneu, beim Abriss und Neuaufbau haben viele Mitglieder geholfen. „Wir wollen zwar klein und bäuerlich sein, aber auch ein bisschen modernisieren.“
Manche würde es Kommune nennen
Der Hof, den Wegerer und ihre Mitstreiter*innen seit 2017 bewirtschaften, gehört seit über 30 Jahren einem gemeinnützigen Verein. Als der vorherige Pächter starb, suchte Wegerer mit ihrem Partner Benjamin Todtmann gerade überall in Deutschland nach einem passenden Hof. Spontan kontaktierten sie die alten Studienfreundinnen. Gemeinsam entschieden drei süddeutsche Frauen und ein Hamburger Mann, in das ihnen unbekannte Bergische Land zu ziehen. „Manche würde es Kommune nennen, ich nicht“, sagt Wegerer und lacht.
Karge Winter mit viel Kohlgemüse
Direkt neben dem Wohnhaus der Pächter*innen liegt der Schweinestall, um den sich Todtmann kümmert. Auf dem Hof wird auch geschlachtet, das Fleisch jedoch nicht über die Solidarische Landwirtschaft verteilt. Es gibt Hühner und einen großen Teich, den sie nach den ersten trockenen Sommern über eine Crowdfunding-Aktion finanziert haben. Während Wegerer über den Hof führt, deutet sich der Frühling gerade erst vorsichtig an. Es ist warm und sonnig, aber die großen Ernteerträge gibt es noch nicht.
An die kargen Winter und das viele Kohlgemüse muss sich manches Neumitglied erst gewöhnen. „Tomaten könnten wir das ganze Jahr über mehr loswerden“, sagt Wegerer. Aber so funktioniert nachhaltige Landwirtschaft eben nicht. Alle Pächter*innen haben im Alltag ihre festen Aufgaben und werden dabei von Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden unterstützt, die in Bauwagen auf dem Hof leben. Das Gelände ist weitläufig, wäre mit seinen 35 Hektar jedoch zu klein, um als konventioneller Hof rentabel zu sein. Durch die Solidarische Landwirtschaft und den zusätzlichen Verkauf trägt sich der Betrieb. Stiftungen finanzieren das Bildungsangebot, bei dem beispielsweise Schulklassen etwas über Landwirtschaft lernen können.
Eine Show zum Frühling
Auf der anderen Seite der Landstraße hält Carolin Hertler, die vierte Pächter* in, eine Kettensäge in der Hand und zerkleinert Äste. Drei junge Frauen helfen ihr dabei. Schon auf dem restlichen Hof waren bis auf Benjamin Todtmann ausschließlich weibliche Pächterinnen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bei der Arbeit zu sehen. „Das ist nicht bewusst so“, sagt Hertler. An einen Zufall glaubt sie aber auch nicht. Viele junge Frauen würden sich deshalb für ihren Betrieb entscheiden, weil er schon so weiblich geprägt ist. Sie hätten keine Lust auf die in der Landwirtschaft nach wie vor weit verbreiteten patriarchalen Strukturen.
Von den konventionellen Landwirt*innen, die im Frühjahr gegen die Bundesregierung auf die Straße gingen, trennt Wegerer einiges. Doch auch wenn sie sich an diesem Protest niemals beteiligt hätte, teilt sie deren Ärger über ein System, in dem vielfältige Kleinbetriebe kaum überleben können. Alternative Konzepte wie die Solidarische Landwirtschaft und immer größere monokulturelle Betriebe seien zwei Arten, mit demselben Problem umzugehen. „Inhaltich kann ich die Nöte verstehen“, sagt Wegerer.
Doch dieser Frühlingsmorgen endet nicht mit Sorgen, sondern mit natürlicher Freude. Für die Kühe auf Hof Vorberg ist es nämlich ein besonderer Tag. Sie werden zum ersten Mal in diesem Jahr auf die Weide gelassen und bedanken sich mit Freudensprüngen und Grasbüschelwürfen. Am Rand stehen die Pächter*innen und verfolgen die Show. Schon beim Besuch in der Käserei hatte Maria Ballhaus für den Termin geworben. „Das lohnt sich“, hatte sie mit einem Lächeln im Gesicht gesagt.
Weitere Themen
Abschied
Armut
Aufbruch
Wohnen
Zusammenhalt
Berührung
Ankommen
Einsamkeit