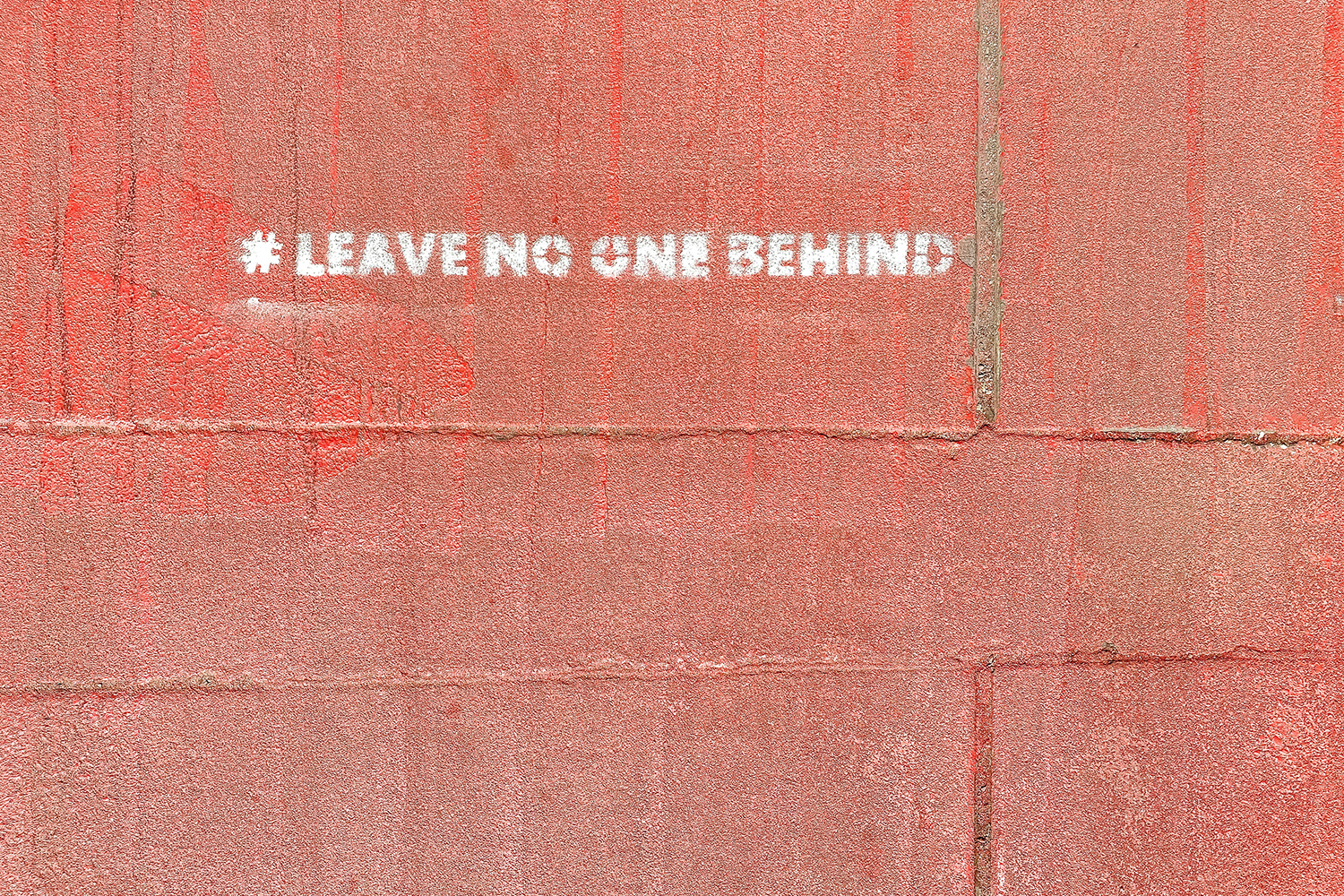Gespräch: Kira Küster, Foto: Etienne Girardet auf Unsplash
Was ist Solidarität eigentlich genau? Was kann sie leisten? Wann handeln wir solidarisch? Und wann nicht? Antworten auf diese Fragen hat der Philosoph und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Robin Celikates im Interview mit unserem Magazin dialog gegeben.
Solidarität ist ein sehr abstrakter Begriff, zu dem man unterschiedliche Definitionen finden kann. Wie würden Sie Solidarität beschreiben?
Solidarität ist ein relativ vager Begriff, der von politischen Akteuren, von der EU, von der Regierung, von vielen Medien und sozialen Bewegungen auf sehr unterschiedliche Weise und zum Teil auch auf widersprüchliche Weise verwendet wird. Man wird wahrscheinlich den Streit um die richtige Definition von Solidarität nicht ganz auflösen können. Was hilft, ist Solidarität erstmal abzugrenzen von benachbarten Begriffen, wie beispielsweise Hilfsbereitschaft oder, im religiösen Kontext, Barmherzigkeit. Sie überlappen mit Solidarität, weil man auch bei ihnen die Vorstellung hat, mit anderen Menschen in Not zusammenzustehen. Dieses Zusammenstehen ist sehr wesentlich für die Begriffsgeschichte von Solidarität. Allerdings ist Solidarität schon von vornherein mehr auf Symmetrie ausgerichtet, also darauf, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, zusammenstehen und zusammen auch eine gemeinsame Herausforderung annehmen und zu bewältigen versuchen.
Bei Hilfe und Barmherzigkeit steht auf der einen Seite der Helfer, auf der anderen Seite die klar definierte Gruppe, der geholfen werden muss und die relativ passiv bleibt. Die Beziehung ist asymmetrisch. Hierbei geht es weniger um die strukturellen Hintergrundbedingungen, die dazu geführt haben, dass diese Situation aufgetaucht ist.
Gibt es weitere Möglichkeiten sich dem Begriff zu nähern?
Eine andere Differenzierung, die für die gegenwärtige Diskussion wichtig ist, bezieht sich auf Émile Dürkheim, den französischen Sozialtheoretiker. Er versteht Solidarität als sozialen Zusammenhalt oder soziale Integration: Was hält die Gesellschaft zusammen? So wird der Begriff Solidarität heute häufig verwendet. Zum Beispiel in der Politik, wenn gesagt wird, dass der soziale Zusammenhalt in der Krise stecke, die Gesellschaft auseinanderdrifte und wir den sozialen Kitt wieder stärken müssten. Die Idee dahinter ist: Es gibt eine organisch zusammengefügte Gesellschaft, die durch sozialen Zusammenhalt gekennzeichnet ist. Und dann gibt es Tendenzen der Fragmentierung, die mit verschiedenen Formen von Differenz zu tun haben. Solidarität ist aber von sozialem Zusammenhalt zu unterscheiden. Sozialer Zusammenhalt kann auf Ausschluss beruhen und höchst undemokratisch sein. Solidarität ist sehr viel anspruchsvoller. Zudem bezieht sich Solidarität auf ein Zusammenstehen auch über Differenzen hinweg, setzt also gerade keine Gemeinsamkeit voraus, sondern erzeugt diese.
Die Vorstellung, sozialer Zusammenhalt setze Gemeinsamkeit oder gar Homogenität voraus, ist nicht nur höchst problematisch, sondern auch empirisch und historisch nicht besonders plausibel, und sie hilft auch gar nicht, Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu finden. Solidarität hieße demnach, dass wir nur mit jenen zusammen sein wollen, die uns ähnlich sind, Solidarisierung unter Gleichen sozusagen. Solidarität sollte dem Prinzip nach aber über schon bestehende Identitäten oder Identifikationen hinausgehen und verlangt, bereit zu sein, sich zumindest ein Stück weit zu verändern.
Meinen Sie mit Formen der Differenz zum Beispiel kulturelle Differenz durch Migration?
Migration muss oft für die Vorstellung herhalten, dass mit ihr alles schwieriger würde. Das ist eine problematische Sichtweise, weil sie sehr häufig zu Entsolidarisierung führt. Beim Thema Migration wird häufig so getan, als würden die Geflüchteten sozusagen aus dem Nichts nach Deutschland kommen, aus einer Welt, mit der wir gar nichts zu tun haben. Obwohl natürlich – wenn man sich die Geschichte des Kolonialismus anschaut oder eben auch die Wirtschaftsgeschichte, den Kapitalismus und die gegenwärtigen globalen Beziehungen – klar ist, dass wir sehr aktiv die Bedingungen mitproduzieren, die Menschen zur Flucht zwingen; natürlich nicht durchgängig und nicht nur wir, aber doch eben auch.
Das heißt, Solidarität bezieht sich auch darauf, dass man Zusammenhänge erkennt und sieht, dass wir Teil eines global umspannenden Netzwerks an Beziehungen, an Abhängigkeiten sind, und wir die damit einhergehenden Probleme als eine gemeinsame Herausforderung begreifen sollten.
Der Soziologe Heinz Bude sagt, dass Solidarität darauf beruhe, dass wir ein Bewusstsein der eigenen Verwundbarkeit haben; der Theologe Bernd Habeck-Pingel fokussiert stärker darauf, bei Solidarität die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, durchaus. Und ich finde, dass beide Recht haben und einen wichtigen Punkt benennen. Sich der eigenen Verwundbarkeit bewusst sein, ist vielleicht eine andere Beschreibung dessen, was ich zuvor mit wechselseitigen Abhängigkeiten angeführt habe. Dabei geht es aber nicht nur um Verwundbarkeit, weil Wechselseitigkeit auch positive Aspekte mit sich bringt und durchaus auch Handlungsfähigkeit kreiert. Aber die Tatsache, dass wir uns weder als Individuum noch als Gesellschaft herausdenken können aus den globalen Abhängigkeiten und Relationen, ist existenziell.
Die Corona-Krise war auch ein gutes Beispiel für gemeinsamen Handeln.
Ja. Die meisten, wenn auch nicht alle, haben in dieser Krise eingesehen, dass man nur dann sicher sein kann, wenn alle sicher sind. Häufig ist die erste Reaktion in solchen Krisensituationen, dass die Grenzen geschlossen werden und zuerst einmal geschaut wird, dass es uns selbst gut geht. Ich glaube, die Krisen der Gegenwart, wie etwa die Klimakrise, die Corona-Pandemie und die Migration, sind derart, dass man die eigene Vulnerabilität nicht leugnen kann und nicht glauben darf, man könne sich selbst herausziehen. Eine Strategie der Abgrenzung wird nicht funktionieren.
Solidarität hat niemals einfach nur als Erklärung oder Deklaration funktioniert.
Der Fokus auf die Handlungsmöglichkeiten erscheint mir gerade deshalb zentral, weil Solidarität häufig rein symbolisch bleibt und damit eher eine Art von Pseudosolidarität wird. Einfach nur irgendwo etwas anzuklicken oder floskelhaft zu wiederholen, dass man solidarisch sei mit den von Krieg und Vertreibung Betroffenen, das reicht nicht.
Diese Handlungsmöglichkeiten sind auch deshalb so wichtig, weil Solidarität sonst plötzlich sehr billig wird – sonst könnte man sich mit allen und jedem solidarisch erklären, ohne dass daraus irgendetwas folgt. Wenn man sich soziale Bewegungen anschaut, in denen Solidarität eine wichtige Rolle gespielt hat, waren sie stets gelebte Praxis. Solidarität hat niemals einfach nur als Erklärung oder Deklaration funktioniert. Das gilt natürlich auch für andere normative Ideale, die für die Praxis leitend sind. Nehmen wir das Beispiel der Freundschaft: Wenn ich behaupte, dass wir befreundet sind, dann muss daraus auch irgendetwas folgen, also etwa in einer Situation, in der ich auf diese Freundschaft angewiesen bin. Wenn das nicht der Fall ist, erweist sich die Freundschaft als leer. Das gilt genauso für die Solidarität.
Was kann Solidarität leisten?
Wir sind zwar schon durch vielfältige Abhängigkeitsverhältnisse miteinander verbunden, aber wir haben noch keine politische Form für diese Verbindung gefunden, die dem Rechnung trägt und es uns ermöglicht, adäquat auf die Krisen und Herausforderungen der Zeit zu reagieren. Das muss erst durch die harte Arbeit der Solidarisierung ermöglicht werden. Dazu gehört, dass wir uns erstmal klarmachen, dass so etwas wie Migrations- oder Fluchtbewegungen nicht aus dem Nichts über uns hereinbrechen und wir nicht einfach so entscheiden können: „Die lassen wir rein und die nicht.“ Wir müssen realisieren, dass die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft organisieren und auch die Vorteile, die das mit sich gebracht hat und von denen wir heute zehren, wesentlich auf Kosten anderer ermöglicht worden sind. Dafür tragen wir eine gewisse Verantwortung.
Diese Verantwortung ist notwendig kollektiv, denn solidarisches Handeln von Einzelnen ist dauerhaft nicht möglich. Solidarität braucht Infrastrukturen oder Institutionen. Dafür ist der Wohlfahrtsstaat ein gängiges Beispiel. Hier wird Solidarität gewissermaßen kollektiviert und institutionalisiert. Wenn es mir einmal schlecht gehen sollte, bin ich nicht auf irgendjemanden angewiesen, der mir Geld spendet, sondern ich weiß, wenn ich durch Arbeitslosigkeit, Unfall oder Alter in eine schwierige Situation gerate, gibt es ein solidarisches Konstrukt, das mich unterstützt. Ähnliche solidarische Infrastrukturen müsste man heute viel stärker transnational oder global denken – besonders in Bereichen wie Gesundheit, Migration, Bildung oder auch Arbeit, die ja de facto nicht an staatlichen Grenzen haltmachen.
Kann sich Solidarität als gesellschaftliche Ressource erschöpfen?
Krisen sind sehr interessant, um sich Solidarität genauer anzuschauen, weil dann verschiedene Aspekte deutlicher hervortreten. Einerseits zeigen sich in Krisen sehr genau die Lücken der Solidarität und welche Menschen durch diese Lücken hindurchfallen, weil sie nicht die entsprechenden Rechte haben, die Institutionen einseitig funktionieren oder eben von vornherein bestimmte Interessen gar nicht berücksichtigen. Das war in der Corona-Krise und in der Migrationskrise so. Gleichzeitig gibt es Versuche, dies entweder zu verdecken oder zu kompensieren, indem Politiker:innen zum Beispiel an die Solidarität der Zivilgesellschaft appellieren: „Wir sind in der Krise, jetzt müssen alle ran.“ Das ist quasi ein Schuldeingeständnis: Die Institutionen versagen, weil jahrelang gespart worden ist beim Gesundheitssystem und dem Wohlfahrtsstaat. Deshalb kann auf Krisen nicht mehr adäquat reagiert werden. Die Krankenhäuser sind zum Bersten gefüllt und kurz davor, nicht mehr zu funktionieren, und dann wird eben gesagt: „Okay, Leute, ihr müsst euch jetzt erstmal selber helfen, füreinander einkaufen gehen, nacheinander gucken, den Leuten die Medizin nach Hause bringen.“ Das wäre alles nicht nötig, wenn wir in einer institutionell gut funktionierenden solidarischen Gesellschaft leben würden.
Können Sie dafür ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, in Berlin war es zum Beispiel so, dass in der Corona-Pandemie lokale Gesundheitszentren und Initiativen extrem wichtig waren für medizinisch unterversorgte und sowieso benachteiligte Stadtteile wie Kreuzberg und Neukölln. Diese lokalen Zentren stellten den Bewohner:innen medizinische Versorgung und Informationen zum Beispiel über Impfungen zur Verfügung - auch in unterschiedlichen Sprachen. Das hat das offizielle Gesundheitssystem nicht hinbekommen. Das war einerseits natürlich ein gutes Beispiel für echte Solidarität von unten. Aber andererseits darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche Lücken nicht von Natur aus existieren, sondern durch politische Entscheidungen und soziale Prozesse entstanden sind. Die Lücken werden ein Stück weit unsichtbar gemacht, und die Lage verschlimmert sich, wenn gesagt wird „Wir müssen als Gesellschaft zusammenstehen“. Das ist die Ambivalenz von Solidarität in der Krise. Ich glaube schon, dass Menschen in Krisenzeiten dazu in der Lage sind, solidarisch zu handeln und nicht nur auf ihr eigenes Wohl bedacht zu sein. Aber es reicht eben nicht aus, wenn es nicht auch Institutionen und öffentliche Infrastrukturen gibt, die sie darin unterstützen oder das selbst leisten.
Und deswegen muss man beides im Blick behalten. Einerseits gibt es unglaublich eindrucksvolle zivilgesellschaftliche Praktiken der Solidarität, gerade in Krisenzeiten, die nicht vom Staat organisiert sind. Aber andererseits darf man sich nicht darauf verlassen, weil es die genuine Aufgabe des Staates und der politischen Gemeinschaft ist, dauerhafte Antworten auf Krisen zu finden.
In der Flüchtlingskrise gab es eine große Solidarität mit den Geflüchteten. Davon ist heute kaum mehr etwas übrig. Woran liegt das?
Zwei Punkte sind dabei wahrscheinlich entscheidend. Die Solidarität kann natürlich kippen, wenn man den Eindruck hat, dass es nicht die entsprechenden öffentlichen und auch staatlichen Unterstützungsmaßnahmen gibt, die den Druck langsam von der Zivilgesellschaft und den Einzelnen wegnehmen. Das ist ein Punkt. Zweitens ist leider in den letzten Jahrzehnten ein Diskurs entstanden und verstärkt worden, der Migration zu dem Problem schlechthin stilisiert und suggeriert, dass alle möglichen sozialen Probleme, also etwa bezüglich der kommunalen Finanzen, des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes, mit Migration zu tun haben - was empirisch nachweislich nicht stimmt.
Die Migration ist nicht schuld daran, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat nicht mehr funktioniert
Man weiß aus der historischen Forschung über Migration und den sozialen Diskurs über Migration, dass sich die gesellschaftlichen Einstellungen zur Migration eigentlich gar nicht so sehr auf reale Verschiebungen beziehen, sondern immer durch den politischen Diskurs mitproduziert werden. Der politische Diskurs tut so, als reagiere er auf eine gesellschaftliche Stimmungslage: „In unserem Land wird Migration als das größte Problem schlechthin erfahren. Deswegen müssen wir da endlich dies oder das machen“. Dies wird so lange wiederholt, bis, vereinfacht gesagt, tatsächlich viele Leute denken, dass Migration das größte Problem sei.
Diese medialen und politischen Diskurse haben immer wieder die Stimmung in der Bevölkerung beeinflusst. Das ist ein sehr gefährliches Spiel, weil damit eine falsche Vorstellung über die Krisen unserer Zeit reproduziert wird - als wäre die Migration schuld daran, dass der deutsche Wohlfahrtsstaat nicht mehr funktioniert. Das hat aber ganz andere Gründe, die viel mehr mit einer problematischen Wirtschafts- und Finanzpolitik zu tun haben. Und gleichzeitig stärkt es die Legitimität von Positionen, zum Beispiel aus der AfD, die vorher als anrüchig oder illegitim galten. Im Ergebnis wird die Spaltung der Gesellschaft weiter verschärft. Das ist fatal, weil eigentlich nur ein Mehr an Solidarität angesichts der gemeinsamen Herausforderungen eine politische Zukunftsperspektive bietet.
Weitere Themen
Abschied
Armut
Aufbruch
Wohnen
Zusammenhalt
Berührung
Ankommen
Einsamkeit
Prof. Dr. Robin Celikates ist Philosoph und Sozialwissenschaftler. Er ist Professor für Sozialphilosophie an der FU Berlin, Sprecher des Forschungsnetzwerks „Transforming Solidarities“ und stellvertretender Direktor des "Center for Social Critique".