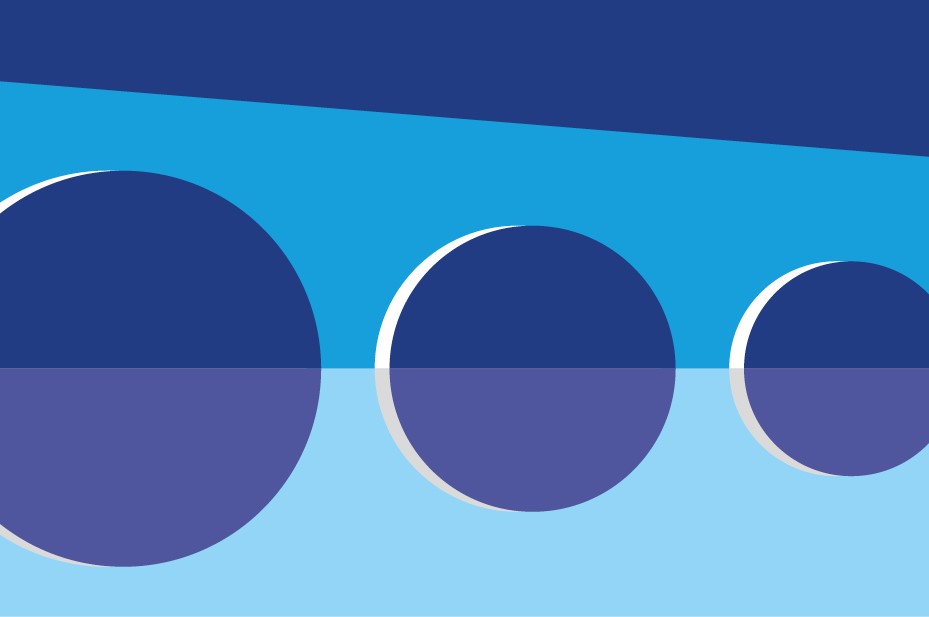Foto: Jonathan Cooper bei unsplash.com
Statt alles Negative aus unserem Leben zu verbannen, sollten wir dunkle Gefühle und Emotionen zulassen und auch mal Nein, sagen, findet Politologin und Autorin Juliane Marie Schreiber. Im Interview erklärt sie, warum sie positive Sinnsprüche nicht leiden kann, weshalb der Glückszwang eine Gesellschaft kaltherzig macht und was wirklich Zufriedenheit bringt.
Bei vielen Menschen hängen im Büro Sinnsprüche auf pastellfarbenem Hintergrund an der Wand, die sie daran erinnern sollen, das Leben positiv zu sehen. Können Sie damit etwas anfangen?
Diese Fülle von positiven Sinnsprüchen überall ist ein Grund dafür, warum ich mein Buch geschrieben habe. Wenn ich solche Sprüche gesehen habe, empfand ich sie als nervig und deplatziert. Diese Art von Sprüchen begegnet einem ja nicht nur im Büro, sondern auch im Supermarkt oder in fast jedem Ratgeber. Ich verstehe, warum Menschen das mögen: Sie wollen sich motivieren und aufbauen. Aber meiner Meinung nach geht das oft am eigentlichen Zweck vorbei. Denn diese Art der Ansprache erhöht den Druck auf uns, wenn eigentlich alles in Ordnung ist. Wir haben das Gefühl, stets noch mehr tun und an uns arbeiten zu müssen, weil angeblich alles an uns oder an unserer Perspektive auf das Leben liegt.
Warum ist das so, dass wir alles Negative aus unserem Leben verbannen wollen?
Das liegt vor allem daran, dass wir in einer sehr individualisierten Zeit leben: Wenn wir etwas Negatives erleben, haben wir das Gefühl, persönlich versagt zu haben. Unser Normalstandard von Zufriedenheit und Glück hat sich verschoben; es reicht nicht mehr aus, durchschnittlich gelaunt zu sein. Und wenn man einmal schlecht gelaunt ist, ist das schon völlig verpönt, weil es so wirkt, als hätte man sein Leben nicht im Griff – fast wie eine Art Funktionsstörung.
Social Media wirkt dabei als Brandbeschleuniger, da wir zum ersten Mal in der Geschichte unser Leben selbst kuratieren können: Wir können es nach außen so darstellen, als sei es perfekt. In Zeiten des relativen Wohlstands grenzen wir uns zu anderen nicht mehr nur alleine über unser Einkommen ab: Die teure Uhr und das große Auto sind zwar weiterhin Statussymbole, aber Glück nun eben auch. Glück ist zum Prestige geworden. Daher denken wir, dass Unglück unseren Status mindere, und das wollen wir nicht zeigen. Denn nur wer glücklich ist, gilt heute als erfolgreich.
Wann hat diese Entwicklung angefangen?
Das ist schwer zu datieren, aber ein wichtiger Treiber war die Positive Psychologie. Sie entstand Ende der 1990er-Jahre in den USA und ist dann Anfang der 2000er-Jahre zu uns herübergekommen. Einfluss hat sie besonders in den letzten zehn Jahren gewonnen. Ihr Begründer, der Psychologe Martin Seligman, geht davon aus, dass man sein Leben zum großen Teil selbst in der Hand hat – ganz egal, wie sich die Umstände unserer Existenz gestalten. Er hat sogar eine ominöse, unter Wissenschaftler*innen umstrittene Glücksformel aufgestellt: Glück ist gleich genetische Voreinstellung plus Umstände plus willentliche Kontrolle, und zwar in einer Aufteilung von 50, 10, 40. Die Positive Psychologie konnte auch so stark werden, weil immer sehr viele Geldgeber bereitstanden, sie zu fördern. Sie passt gut in unsere Zeit: „Wenn du noch dieses Produkt konsumierst oder dieses Video anschaust, dann wirst du irgendwann glücklich sein.“ Dieses Heilsversprechen funktioniert sehr gut im Kapitalismus.
Gab es weitere Einflüsse für diese Entwicklung?
Ja, die neoliberale Politik hat sich mit der Leistungsgesellschaft, der sogenannten Meritokratie, verschränkt. Damit wurde das Glücksstreben eingebettet in die dominante Vorstellung, nach der jeder das bekommt, was er sich aus eigener Kraft verdient. Das äußert sich in dem Spruch: „Du kannst alles sein, wenn du nur an dich glaubst“, also in der Idee, dass man alles selbst in der Hand habe und der Sozialstaat gar nicht gegensteuern müsse, weil der freie Markt alles regle. Diese Haltung hat den Glückszwang nochmals verstärkt. Doch die These stimmt einfach nicht, denn sie ignoriert Chancenungleichheiten. Aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder ihres Geschlechts sind die Startbedingungen der Menschen sehr unterschiedlich. Aber es ist praktisch, denn wenn jeder seines Glückes Schmied ist und alles nur auf die eigene Perspektive ankommt, auf das „Mindset“, dann bin ich als Einzelner viel mehr im Zugzwang: Ich muss mich noch mehr anstrengen. Wir haben dabei aus den Augen verloren, dass auch gesellschaftliche und politische Umstände stimmen müssen, damit man sich entfalten kann.
Diese Individualisierung verändert die Gesellschaft?
Die Kehrseite der Glücksprestige-Medaille ist, dass wir denken, dass jeder selbst schuld sei an seinem Leid. Ich glaube, das ist ganz gefährlich: Wenn jemand arm ist, dann war er nach dieser verqueren Logik nicht fleißig genug; wenn jemand krank ist, dann hat er wohl zu negativ gedacht. Immer zu glauben, dass alles nur an der persönlichen Perspektive läge, macht uns als Gesellschaft kaltherzig, weil wir keine gesellschaftlichen Veränderungen mehr in Gang bringen. Und es ist kurzsichtig, weil wir keine Zusammenhänge mehr sehen können.
Probleme, die eigentlich politisch sind, müssen auch so gelöst werden. Den Pflegenotstand zum Beispiel verbessere ich nicht durch mein Mindset. Anderes Beispiel: In Deutschland braucht es sechs Generationen, damit ein Kind aus Armut entkommt. Wenn man dann sagt: „Du kannst alles sein, wenn du dich nur genug anstrengst“, dann stimmt das einfach nicht. Wenn wir nur versuchen, unsere Perspektive zu verändern und den Glücksgeboten zu folgen, dann ändert sich in der Gesellschaft gar nichts. Wir stabilisieren nur den Status quo.
Das heißt Menschen, die nicht glücklich sind, werden eher ausgegrenzt?
Ich denke schon. Das kennt bestimmt jeder aus seinem Umfeld. Wenn man mal ein Problem anspricht, heißt es schnell: „Komm, hab dich nicht so“, „Reiß dich mal zusammen“ oder „Sei doch nicht so negativ“. Wenn das eine Grundhaltung in der Gesellschaft wird, dass man Menschen, die ihr Leid klagen, gar nicht mehr zuhört und immer nur sagt, es läge nur an ihrer Perspektive, ist das eine Entwicklung, die uns Sorgen machen sollte. Weil sie Menschen ausschließt und zu stark auf Gewinnertypen fokussiert.
Sollte man statt Glück lieber Zufriedenheit anstreben?
Wir jagen dem Glück hinterher, obwohl dieser Zustand sehr flüchtig und auch gar nicht so erstrebenswert ist, denn Menschen werden im Glücksrausch eher egoistisch. Der Sozialpsychologe Joseph P. Forgas hat herausgefunden, dass glückliche Menschen mehr auf sich fokussiert sind und weniger gerne teilen als Menschen, die in einem nichtglücklichen Zustand sind. Damit will ich nicht sagen, dass wir alle melancholisch werden sollen, aber es ist vollkommen in Ordnung, nicht ständig nach dem großen Glück zu streben. Zufriedenheit ist ein Zustand, dem man wieder mehr Raum schenken sollte. Zufriedenheit ist langfristiger, und sie kommt oft, wenn man an Dingen gearbeitet hat.
Sie sagen, dass diese beiden Gefühle Wut und Ärger wichtig sind, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben.
Zum Leben gehört Negativität immer dazu. Negative Empfindungen und Gefühle hätten sich in der Evolution nicht durchgesetzt, wenn sie nicht eine wichtige Funktion hätten. Schmerz ist zum Beispiel ein wichtiger Schutzmechanismus des Körpers. Ohne Schmerz würde man die Hand vielleicht erst von der Herdplatte nehmen, wenn es komisch riecht. Die Erwartung von Schmerz hilft dabei, ohne Verletzungen durch den Alltag zu manövrieren. Und wenn wir uns doch einmal das Schienbein stoßen, dann wirkt Schimpfen wie ein natürliches Schmerzmittel, weil es den Körper in einen Kampfmodus bringt.
Man hat in Experimenten herausgefunden, dass das Schimpfen den Fight-or-Flight-Modus in der Amygdala aktiviert und hilft, Qualen länger auszuhalten. Man kann sogar seelische Schmerzen mit Schimpfen lindern. Auch das wurde in einem Experiment nachgewiesen. Schimpfen kann auch politisch wichtig sein, weil es eine wichtige Form der vorpolitischen Artikulation ist. Es drückt erstmal aus: „Hier gibt es ein Problem.“ Damit wiederum können andere ausdrücken: „Ja, ich habe das Problem auch.“ Alle politischen Veränderungen haben mit Schimpfen begonnen. Die Französische Revolution wäre nicht entstanden ohne das Schimpfen und die Wut der Menschen.
Und warum unterstützt Neinsagen die persönliche Seelenhygiene?
Das Neinsagen ist eine Befreiung, denn darin liegt eine große Autonomie. Wenn ich nach meinen Überzeugungen und Werten leben will, dann kann ich mich nicht von den Anforderungen der anderen, des Konsums, der Normen leiten lassen, sondern muss immer wieder auch Nein sagen. Wer ist man denn, wenn man zu allem immer Ja sagt? Wir haben die Kämpfe insgesamt zu sehr nach innen verlagert. Wir coachen uns, wir wollen unsere Resilienz verbessern, aber wir sollten unsere Kämpfe wieder mehr außen, also in den Umständen suchen. Das haben wir in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Besonders in Zeitender Krisen sollten wir uns nicht davon dominieren lassen, immer noch glücklicher sein zu müssen, immer weiter zu konsumieren, sondern sagen: „Nein, ich muss nicht immer glücklich sein, ich mache mein eigenes Ding und finde darüber vielleicht eine neue Wahrhaftigkeit.“
Wie sind Ihrer Meinung nach Zufriedenheit und Seelenruhe zu erreichen?
Durch Distanz von diesem dauerhaften Maximieren und dass man zu vielen Dingen auch mal Nein sagt. Es ist völlig in Ordnung, nicht ständig etwas optimieren zu wollen, sondern einfach nur hier zu sitzen, wie Loriot sagen würde. Es gibt Dinge, die laufen nicht gut, auch gesellschaftlich, auf die darf ich wütend sein. Und wenn ich Missstände anders anpacken kann als über mein eigenes Mindset, dann gibt mir das ein besseres Gefühl, weil es mich aktiviert. Es macht mich zufriedener, weil ich weiß: „Okay, anderen geht es auch so, und so, wie es mir geht.“
Man muss nicht die ganze Zeit überglücklich sein, denn die meisten Menschen sind es auch nicht. Glück ist sowieso eher ein kognitiver Ausnahmezustand!
Juliane Marie Schreiber ist Politologin, Autorin und freie Journalistin. Im März 2022 erschien ihre Gesellschaftskritik „Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven“ im Piper Verlag und wurde ein Bestseller.
Foto: Juliane Marie Schreiber