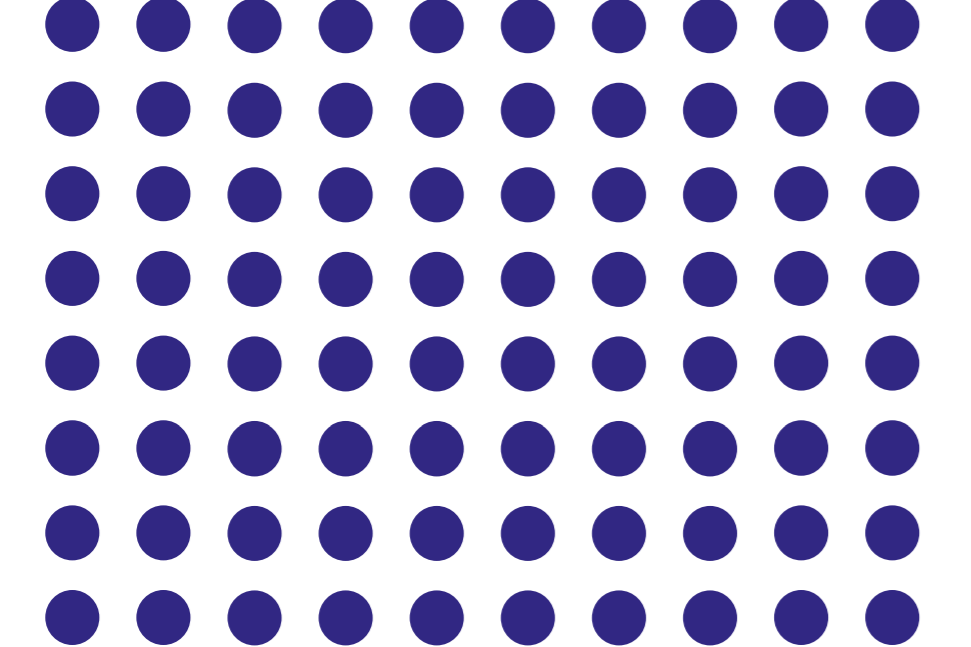Es ist spürbar, aber auch Studien belegen: Der Fremdenhass in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Aber wie lässt sich dieser Hass überwinden? Das fragt sich Zeit-Autor Bastian Berbner in seinem Buch „Geschichten gegen den Hass“. Im Interview erklärt er, warum es so wichtig ist, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen und das notfalls auch zur Pflicht zu machen.
Herr Berbner, für ihre Recherchen haben Sie verschiedene Menschen getroffen, die es geschafft haben, ihre Feindschaft zu beenden – unter anderem einen Neonazi und einen Punker, die gemeinsam durch die Wüste gewandert sind und einen irischen Briefträger, der Homosexuelle nicht mochte, sich dann mit einem anfreundete und am Ende in einer Bürgerversammlung ein Plädoyer für die Homo-Ehe hält. Wie kam es dazu, dass sie sich mit diesen Begegnungen beschäftigt haben?
Das Jahr 2016 war ein Höllenjahr. Egal, wo man hingeschaut hat: Überall nahm die Spannung zu. Da gab es die Brexit-Entscheidung im Sommer und die Trump-Wahl im November. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass der Front National immer stärker wird und in Deutschland die Debatte um die Flüchtlingskrise die Gräben vertieft hat. Da habe ich mich erinnert, dass es Beispiele von Menschen gibt, die es geschafft haben, ihren Hass zu überwinden. Der Gedanke war, dass man aus diesen Geschichten vielleicht etwas lernen kann fürs große Ganze.
Sie verwenden in dem Zusammenhang auch den Begriff analoge Filterblasengesellschaft. Was meinen Sie damit?
Ein menschliches Grundbedürfnis ist es, sich mit Menschen zu umgeben, die einem ähnlich sind. Paradigmatisch ist das in den Großstädten, wo man sagen kann: In dem Viertel wohnen die, und in dem Viertel wohnen die. Das ist natürlich angenehm, weil die Leute, die man kennenlernt, auf der Straße, beim Bäcker, im Supermarkt, im Café, viele eigene Ansichten teilen. Aber es ist auch gefährlich, weil man sich so einrichtet in dieser Welt und auf einmal denkt oder in Gefahr läuft zu denken: Das ist die Realität. Das ist eine große Triebfeder für Vorurteile und wozu diese Vorurteile führen, sehen wir gerade in der politischen Debatte.
Für Ihre Recherchen haben Sie sich unter anderem mit dem Ehepaar Hermes getroffen, das keine Ausländer in Deutschland haben wollte, sich dann aber mit einer Roma-Familie anfreundet, die über ihm einzieht. Auslöser war, dass Christa Hermes sich beschweren wollte, weil Wasser von durchnässter Wäsche vom Balkon tropfte, dann aber bemerkte, dass es der Familie am Nötigsten fehlte, unter anderem an einer Waschmaschine und einem Wäscheständer.
Die Begegnung zwischen der Familie Hermes und der Roma-Familie war eine zufällige Begegnung. Ich nenne auch noch eine Anzahl anderer zufälliger Begegnungen, um zu zeigen, dass sie, wenn sie dann doch einmal stattfinden, sehr häufig einen positiven Effekt haben. Von eher alltäglichen Begegnungen, wie der, über die wir gerade sprechen, bis hin zu sehr extremen, wie der, als der Neonazi und der Punker gemeinsam durch die Wüste gehen.
Harald Hermes freundet sich am Ende zwar mit der Familie an, seine Vorurteile hat er aber immer noch.
Herr Hermes hat am Ende zu mir gesagt: „Wir hatten einfach sehr großes Glück, das waren sehr liebenswürdige Roma. Aber die anderen mag ich immer noch nicht.“ Das ist ein Problem, das die Sozialpsychologie seit Jahren kennt: dass Menschen, die den eigenen Vorurteilen widersprechen, zu Ausnahmen erklärt werden. Gleichzeitig gibt es aber auch Forschungen, die zeigen: Selbst wenn Menschen denken wie Herr Hermes, haben sich ihre Vorurteile trotzdem ein wenig reduziert. Das ist eine Hoffnung machende Erkenntnis.
Darum sind Sie der Meinung, dass man solche Kontakte gezielt herbeiführen muss?
Auf Freiwilligkeit zu setzen, macht wenig Sinn. Wenn Menschen Vorurteile haben, hat das ja seinen Grund: Vorurteile gedeihen aus der Ferne. Und weil man Vorurteile hat, möchte man diese Menschen, auf die sich die Vorurteile beziehen, nicht kennen lernen. Man hält sich fern – eine Spirale kommt in Gang, die für immer größere Vorurteile sorgt.
Sie schlagen deshalb vor, Kontakt zu institutionalisieren. Als Beispiel führen sie auch Botswana an, wo die Beamten nach ihrer Ausbildung in eine ganz andere Region des Landes versetzt werden. Kann das auch in Deutschland funktionieren?
Die Menschen in Botswana haben eine ganz andere Realität, als wir sie hier in Deutschland haben. Sie haben aus dem Nichts eine Nation kreieren müssen, während wir diese Entwicklung über Jahrhunderte hinweg vollzogen haben. Deshalb wäre es fehlgeleitet, dieses Beispiel nachahmen zu wollen. Was ich spannend finde, ist die Idee dahinter. In Botswana waren die Beamten-Transfers nur eines von mehreren Instrumenten, um Stammesidentitäten aufzuweichen und durch eine von allen geleitete Identität zu ersetzen. Ein anderes war ein nationaler Zivildienst. Die Regierung hat gesagt: „Ihr müsst ein Jahr Zivildienst leisten, dürft das aber nicht in der Stadt, in der ihr groß geworden seid, machen, sondern müsst es in einer anderen Region eures eigenen Landes machen – und oft auch in einer anderen Stammesregion.“ Da könnte man sich alles Mögliche ausdenken in Deutschland.
Man könnte innerhalb von Städten die Menschen aus einem sehr bürgerlichen Stadtteil für eine Zeit in einen etwas ärmeren Stadtteil bringen. Leute, die in der Stadt groß geworden sind, könnten eine Zeit aufs Land ziehen, vom Norden in den Süden, vom Osten in den Westen.
Ist es wirklich so einfach? Ist mehr Kontakt die Lösung?
Das ist alles andere als einfach. Man muss wissen, dass es in einer Welt, die den Kontakt institutionalisieren und politisch herbeiführen würde, wie ich es in meinem Buch vorschlage, immer noch sehr viele Konflikte geben würde. Es wäre aber doch etwas friedlicher, als wir das heute sehen, weil all die Konflikte, die auf Vorurteilen basieren, verschwinden würden. Aber das Problem ist ja: Wie kommt man dahin, also wie nähert man sich diesem Idealzustand an? Denn das wäre ja genau das Gegenteil von dem, was wir im Moment sehen, nämlich, dass wir eine immer stärkere Trennung haben zwischen den gegnerischen Lagern, egal, ob links oder rechts, arm oder reich.
Bastian Berbner ist Redakteur bei der Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT. 2019 wurde er für seinen im SZ-Magazin erschienen Beitrag „Ich und der andere“ mit dem Egon Erwin Kisch-Preis ausgezeichnet. Zu seinen „Geschichten gegen den Hass“ gibt es auch einen Podcast. Reinhören können Interessierte hier: www.hundert-achtzig.de