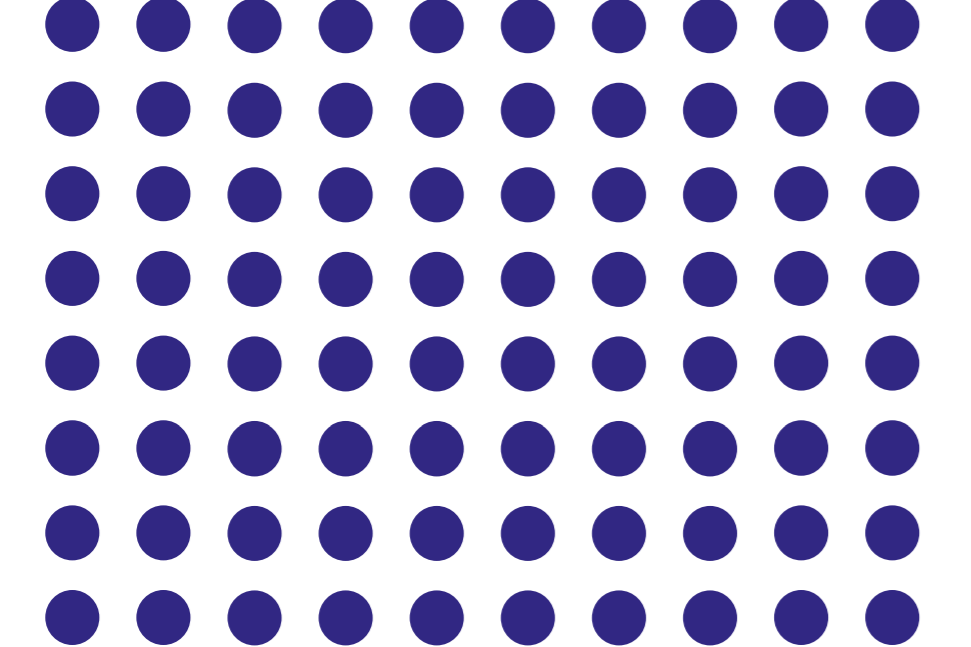„Normalität fällt nicht auf“
Das Gespräch führte der Düsseldorfer Journalist Thomas Becker
Herr Professor Uslucan, das Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund prägt gesellschaftliche Debatten derzeit wie kaum ein anderes. Woran liegt das?
Wenn man früher gefragt hat, was die großen gesellschaftlichen Themen in Deutschland sind, ging es meist um Rente, Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot. Spätestens seit 2015 aber haben wir eine Fokussierung auf die Themen Migration, Zuwanderung und Integration. Gleichwohl hat dies für das Leben des Einzelnen zunächst wenig Veränderung gebracht, wenn man etwa auf das finanzielle Niveau von Sozialhilfeleistungen schaut. Die gespürte Problematik für das Thema ist jedoch sehr, sehr hoch. Ein Wendepunkt war dabei die Diskussion um Thilo Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ aus dem Jahr 2010. Mit der Fluchtzuwanderung seit 2015 hat sich die Fokussierung auf Integrationsthemen noch einmal verdichtet. Die Debatte kreist vor allem um Herkunftsländer, die nicht der Europäischen Union angehören und zudem muslimisch geprägt sind. Hier erleben wir eine starke Politisierung in Teilen der Bevölkerung.
In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ haben Sie einmal gesagt, wir müssten weg von einem defizit-orientierten Diskurs. Was meinen Sie damit?
Lange war in Deutschland die unausgesprochene Forderung, Integrationsleistungen von denjenigen zu verlangen, die zu uns kommen. Das ist ein sehr statisches Modell, als gäbe es eine fixe deutsche Gesellschaft, die unveränderlich ist – und der andere soll gucken, wie er seinen Wertehaushalt, seine Kenntnisse und Kompetenzen anpasst. Wir sollten weg von diesem Defizitdiskurs, der verbunden ist mit der Frage: Was fehlt denen, um so zu sein wie wir? Und hin zu einem Diskurs, der fragt: Wie können wir gleichberechtigte Teilhabe schaffen, sodass alle Menschen in Deutschland jenseits von kulturellem und sprachlichem Hintergrund die gleichen Chancen haben. Wenn man Integration so versteht, fällt schnell auf, dass nicht nur Zuwanderer von Benachteiligungen betroffen sind, sondern es auch in der Mehrheitsgesellschaft viele Personen gibt, die nicht die gleichen Chancen haben.
Zuwanderinnen und Zuwanderer sind speziellen psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Wodurch sind sie gekennzeichnet?
Hier muss man trennen. Zum einen gibt es die freiwillige Migration, bei der in der Regel Menschen nach Deutschland kommen, die hier arbeiten wollen. Auch sie haben psychosoziale Belastungen und Hürden zu überwinden. Wenn man aber freiwillig auswandert und zuvor etwa durch Sprach- und Orientierungskurse gefördert wurde, ist das Ankommen deutlich einfacher, als wenn man unfreiwillig die Heimat verlassen musste, um die nackte Haut zu retten, und kein Wort Deutsch spricht. Belastungen sind zudem höher, je älter Zuwanderer sind, die nach Deutschland kommen. Gerade in der frühen Kindheit lernt man Sprachen deutlich einfacher und schließt auch leichter Freundschaften. Ungelernte Arbeiter oder Analphabeten im Erwachsenenalter werden sich dagegen tendenziell schwerer tun, weil Bildungsvoraussetzungen fehlen. Aber auch Akademiker sind Belastungen ausgesetzt, wenn beispielsweise ihre Abschlüsse und Berufserfahrungen nicht anerkannt werden. Das ist mit starken Entwertungserlebnissen verbunden.
Welche Rolle spielt das Herkunftsland dafür, wie schnell sich neu Zugewanderte in Deutschland einleben?
Generell gilt: Je größer die kulturelle Distanz zu Deutschland ist, desto schwerer ist das Ankommen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand aus Schweden oder aus dem Iran nach Deutschland kommt. Auch spielt eine Rolle, ob es hier schon eine ethnische Community gibt. Wer etwa aus der Türkei in eine deutsche Großstadt zieht, findet in der Regel eine Gemeinschaft vor. Oft ist abfällig von Parallelgesellschaften die Rede, aber für den Einzelnen erleichtern sie das Ankommen enorm. Ganz gleich aus welchem Herkunftsland jemand kommt, ist zudem die Frage: Welche rechtlichen Hürden werden Zuwanderern auferlegt? Welche Erfahrungen von Diskriminierung machen sie? Begegnen sie einer Auffanggesellschaft oder einer, die ihnen zu verstehen gibt, dass sie nicht dazugehören? Das kennen wir etwa aus der Islamdebatte, wenn gesagt wird, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Das geht mit Kränkungserlebnissen einher. Häufig werden Muslime auch generell und kollektiv für Terror- und Gewaltakte haftbar gemacht, die Einzelne begangen haben. Wenn sie von Schreckensnachrichten hören, geht immer ein Ruck durch Muslime. Sie hoffen: Lieber Gott, lass es keinen Muslim gewesen sein! Oder keinen Migranten, weil man kollektiv in Haft genommen wird.
Was ist nötig, damit Integration gelingt?
Was lobenswert ist und positive Veränderungen gebracht hat, sind Sprach- und Orientierungskurse. Zwar besteht noch Verbesserungsbedarf, was die Qualität und den Umfang angeht, aber dass es diese Kurse überhaupt gibt, ist ein Erfolg. Man kann staatlicherseits und auf organisatorischer Ebene zudem Begegnungsräume anbieten, etwa an öffentlichen Plätzen, oder niedrigschwellige Angebote machen. Da sind unter anderem kirchliche Einrichtungen gefragt, um offenen Raum für vorurteilsfreien Austausch zu schaffen. Wichtig ist zudem, Menschen nicht nur als Geflüchtete, Ausländer oder Migranten zu sehen, sondern – theologisch gesprochen – in ihrem ganzen Menschsein. Im Alltag neigen wir leider dazu, im anderen nur den Vertreter seiner Kultur zu sehen. Hier wäre es wichtig, den Blick nicht auf die kulturelle oder religiöse Zugehörigkeit zu verengen.
Wo sehen Sie Erfolge einer gelungenen Integration?
In vielen Bereichen, etwa der Bildung: Die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten mit Zuwanderungshintergrund lag im Jahr 2000 noch bei rund 20 Prozent. Aktuell ist die Quote auf 28 Prozent gestiegen. Das ist ein Riesenerfolg, fällt aber nicht so auf, weil auch die Rate der Einheimischen, die Abitur machen, deutlich gestiegen ist. Unter Zuwanderern gibt es zudem eine Vielzahl von Gewerbetreibenden und Selbstständigen, die niedrige Schulabschlüsse haben und es dennoch schaffen, ihre Familien zu ernähren. Vielen gelingt es, trotz täglicher Entwertungen, Beleidigungen und Rassismen psychisch gesund zu bleiben. Dahinter steckt eine enorme Kraft, um am Alltag nicht zu verzweifeln und auch die Rolle des Zweitplatzierten zu akzeptieren – obwohl sie den gleichen Platz beanspruchen könnten wie ein Einheimischer. Das sind Aspekte, die wir viel zu wenig sehen. Viele Familien schaffen es, trotz schwieriger Ausgangsbedingungen einigermaßen normal zu bleiben, nicht von Sozialhilfe abhängig zu sein, nicht gewalttätig oder psychisch krank zu werden. Die Normalität fällt aber leider nicht auf. In der Normalität ist ein Erfolg zu sehen, der im Diskurs oft verkannt wird.
Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan ist Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen und war bis Ende Juni 2019 stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Er gilt als einer der profiliertesten Integrationsforscher Deutschlands.